Im Zusammenhang mit dem in letzter Zeit viel gescholtenen Taylorismus kommt auch der Name Adam Smith gelegentlich ins Spiel. Dabei werden ihm auch neoliberale Ideen zugeschrieben, beispielsweise dass sich die Ökonomie selbst mit „unsichtbare Hand“ regulieren würde, wenn man sie frei laufen lässt. Eine aktuell erschienene Biographie über das Leben und Werk von Adam Smith zeigt jedoch völlige andere Seiten und Haltungen des schottischen Moralphilosophen – die auch heute noch oder gerade wieder hoch aktuell erscheinen.
Mitgefühl und Einbildungskraft
Menschen können alleine nicht gut überleben, suchen deswegen die Gemeinschaft mit anderen Menschen, und sind dafür auch bereit, sich den Regeln und Erwartungen der jeweiligen Gemeinschaft unterzuordnen. Wir werden bereits mit der Fähigkeit geboren, uns in andere hinzufühlen, was Adam Smith zufolge eine viel elementarere und frühere Form der menschlichen Kommunikation ist, als die Sprache. Wir benutzen hierzu unsere Einbildungskraft und überwinden so die Grenzen unserer eigenen Person.
„Sollte das in unserer Vorstellung Nachempfundene mit den Gefühlsäußerungen der Betroffenen korrespondieren, bspw. mit der Bekundung von Trauer, dann billigen wir diese, sonst missbilligen wir sie“ (S. 68). In dieser Weise fällen wir Werturteile über andere und werten das Verhalten anderer. Dabei ist unsere Bereitschaft, mit den Affekten anderer zu sympathisieren, individuell, situativ und kulturell verschieden.
Smith unterscheidet körperliche (Hunger), psychische (Angst, Kummer), unsoziale (Hass, Vergeltungswunsch), soziale (Güte, Mitleid) und selbstbezogene (Glück, Unglück) Ursachen für unsere Affekte und meint, dass es jeweils darauf ankäme, wie weit wir diese nachvollziehen können. Weil wir Menschen davon ausgingen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und für sich sorgen muss, akzeptierten wir grundsätzlich selbstbezogene Affekte wie Kummer, Freude, Glück, Trauer etc. Allerdings nur in gewissen Maßen. So sei die Sympathie mit selbstbezogenen Affekten weniger intensiv als bei sozialen Affekten und ebenso sei auch die Abneigung weniger intensiv als bei unsozialen Affekten. (S. 74)
Smith sagt: Werden die selbstbezogenen positiven Affekte zu stark (zu großes Glück), schwindet die Anteilnahme und geht über in Neid. Geringe selbstbezogene negative Affekte (zu kleines Unglück) können wiederum übergehen in Gespött.
Gerechtigkeitssinn inkl. Sympathie mit dem Bösen
Nach Smith verfügen wir über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. So kann bspw. ein Vergeltungsgefühl entstehen, wenn wir Ungerechtigkeit wahrnehmen. Wir sympathisieren dann unter Umständen sogar mit dem unsozialen Gefühl, Böses mit Bösem zu vergelten.
Das Vergeltungsgefühl scheint ein Ausgleichsbedürfnis zu sein. Wobei es dabei nicht um Rache, sondern um Fairness geht. Andere können akzeptieren, dass wir besser sein wollen, aber eben nicht dadurch, dass wir anderen hierzu unmittelbar schaden.
Bei unsozialen Affekten wie Hass, Rache und Vergeltungswunsch teilt sich Smiths Idee nach die Sympathie zwischen Subjekt und Objekt auf. Das Mitgefühl mit der einen Person, bspw. mit einem Vergeltungswunsch, wird durch das mit der anderen, bspw. Mitleid, reduziert. Deswegen erreicht die „Sympathie mit unsozialen Affekten nie die Intensität, wie dies bei sozialen Affekten der Fall ist“ (S. 71). Oder anders formuliert, wirken soziale Affekte (Wohltätigkeit, Güte, Achtung, Edelmut, Mitleid etc.) doppelt: auf den Gebenden und auf den Erhaltenen.
Unser Gerechtigkeitssinn richtet sich dabei nicht nur gegen andere, sondern möglicherweise auch gegen uns selbst. Wir nennen das dann Gewissensbisse.
Interessant finde ich, dass wir diesen Gerechtigkeitssinn auch über die Spieltheorie empirisch bestätigen können: Geben wir zwei Menschen 100 Euro nur unter der Bedingung, dass sie sich über die Aufteilung einigen können, ziehen Menschen es regelmäßig vor, lieber gar nichts zu erhalten, als wenig aber in ungerechter Verteilung.
Moralisches Wissen und der Wunsch, liebenswert zu sein
Um richtig zu urteilen und zu handeln, im Sinne einer normativen Ethik, genügt Mitgefühl jedoch nicht. Es müssen auch eigene Vorannahmen hinterfragt werden (S. 76).
Wir streben danach, zu Recht liebenswert zu sein. Hierzu lernen wir, uns mit den Augen anderer zu sehen, also ein multiperspektives Selbstbild zu entwickeln. Erst durch dieses Bemühen nach Überparteilichkeit können wir das Richtige erkennen und moralisches Wissen erlangen. Dieses moralische Wissen kann mit der öffentlichen Meinung einhergehen, muss aber nicht (S. 77).
Wenn wir sagen, dass wir als aufgeklärte Menschen der Wahrheit verpflichtet sind und nicht einfach tun und lassen, was andere uns vorschreiben oder von uns erwarten, dann ist dieses moralische Wissen gemeint. Dieses Wissen ist nach Adam Smith das „einzige wirklich funktionierende Heilmittel gegen Opportunismus und Konformismus“ (S. 78).
Weil wir gesellige Wesen sind, sind uns die Urteile anderer nicht egal. Wir streben nach Wertschätzung durch andere Menschen. „Im Rahmen unserer Sozialisation“ sind wir dafür sogar bereit, unsere Ansichten so zu ändern und unsere Affekte so zu konditionieren, das andere sie billigen oder zustimmen können (S. 78).
Worüber ich in der Biographie wenig finden konnte (S. 79), was mich aber noch interessiert hätte, wären die Gedanken Adam Smith zum Einfluss des Selbstwertgefühls.
Pflichtgefühl
Was uns hingegen nicht angeboren sei, sondern auf Erfahrung und rationaler Einsicht basieren würde, sei das Pflichtgefühl (S. 79). Vermutlich ging Adam Smith davon aus, dass wir beobachten, wie unser Verhalten auf andere wirkt und hierzu Thesen über mögliche Zusammenhänge bilden. Pflichtgefühl ist für Adam Smith dann das Bestreben, „alle jene Handlungen zu vermeiden, die uns hassenswert, verächtlich und straffällig machen müssten“ (S. 79).
„Die aus Erfahrung als vernünftig erachtete Befolgung von Pflichten führt zu ‚Seelenruhe, Zufriedenheit und Genugtuung über das eigene Verhalten‘ und schafft zudem eine gerechtere Gesellschaft“, wird Adam Smith zitiert (S. 80). Weil dies aber nicht angeboren ist, bedarf es gesellschaftlicher, staatlicher und organisatorischer Rechtssysteme zur Gewährleistung der Pflichten durch Sanktionen und Belohnungen.
Ich stelle mir hier die Frage, ob Pflichtgefühl auch mit dem Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft korrespondiert und ob darüber das Phänomen der Verantwortungsdiffusion zu erklären ist? Fühlen wir uns beispielsweise dem Nahbereich von Familie, Freunden oder Nachbarschaft mehr zugehörig, als vielleicht dem Staat, einer Organisation oder einer Nation, dann müsste das Pflichtgefühl in Abhängigkeit davon unterschiedlich ausgeprägt sein.
Außerdem geht er auch davon aus, dass es unmittelbare Übertragung von Gefühlen ohne kognitive Anstrengung gibt, beispielsweise Panik (S. 97).
Abschluss
Adam Smith lebte in einer ganz anderen Zeit und Gesellschaft als wir heute. Die Nöte und Abhängigkeiten durch Hunger, Armut, Versklavung, Ketzerei, sozialer Herkunft etc. scheinen, obwohl noch immer vorhanden, nicht mit der damaligen Zeit zu vergleichen. Und doch passen viele seiner Gedanken ebenso gut noch in unsere Zeit.
In Anbetracht seiner Biographie und seiner Werke erscheint die Vereinnahmung seiner Person für neoliberale Ideen eher abwegig. Es erscheint mir als ein historisches Missverständnis, gerade ihm die Befürwortung völlig ungeregelter Marktmechanismen zuzuschreiben. Seine Gedanken zum angeborenen Mitgefühl, einem natürlich ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und einem gelernten Pflichtgefühl finde ich hingegen auch im Kontext von Organisationen hilfreich.
Die im Text angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die jüngst erschienene Biographie „Adam Smith, Wohlstand und Moral, eine Biographie“ von Gerhard Streminger (Verlag C. H. Beck, 2017, http://www.chbeck.de/streminger-adam-smith/product/17770115), die ich hiermit empfehlen möchte: Ein unterhaltsames und sehr lesenswertes Buch.
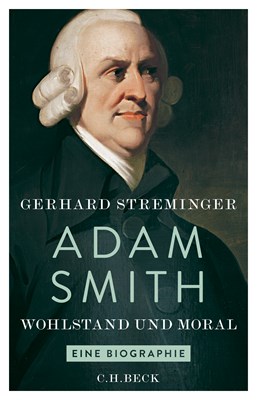
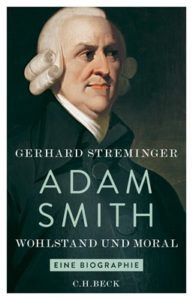
Neueste Kommentare